KW 21/2020
Covid-19 vs. COVID-19
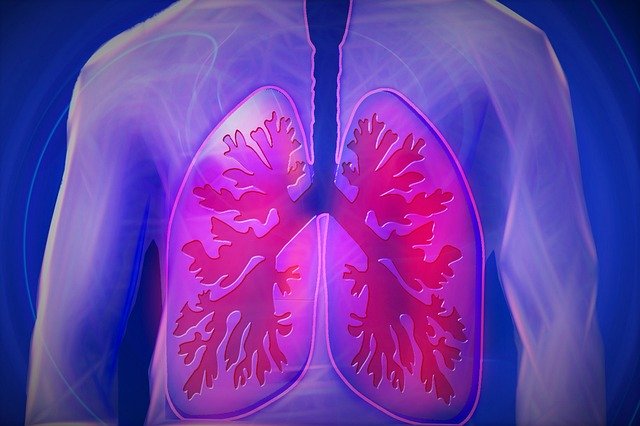 Für die Lungenerkrankung, die durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelöst werden kann, existieren vor allem zwei Schreibungen: Covid-19 und COVID-19. Dabei gäbe es eine weitere Möglichkeit, die wie beim Virus an der Vollform orientiert wäre – schließlich handelt es sich bei CoV und COVID um Kurzwörter, die aus dem Wort (resp. der Wortgruppe) Corona Virus (Disease) gebildet worden sind. Der Orthografie des Virus entspräche also CoViD-19; so wird orthografisch auch bei einigen anderen Kurzwörtern verfahren (IdW, LfV, KiTa, GfdS). Auf welche Schreibung sollte nun also die Wahl fallen? Am transparentesten ist zweifelsohne CoViD-19, da die Großbuchstaben auf Wortanfänge hindeuten. Folgt man der WHO bzw. ihrer ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), verwendet man die Großschreibung COVID-19. Kleingeschrieben ist das Wort am auffälligsten, da nur wenige Kurzwörter, die auf Wortgruppen basieren, kleingeschrieben werden (Destatis, Haribo); selten, aber üblicher ist diese Orthografie bei Kurzwörtern, die auf einem einzelnen Wort basieren, bei denen also die Schreibung der Originalschreibung entspricht (Lkw, Kfz, Awo). Covid hat allerdings einen Vorgänger: Auch bei SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) wurde die Kleinschreibung Sars – nach anfänglicher Großschreibung – bevorzugt verwendet. Womöglich fand hier eine Anpassung an die grundlegende Orthografie der deutschen Sprache statt, begünstigt durch die Aussprachemöglichkeit der Kurzform, eine typografische Abschwächung und/oder die Unkenntnis der Vollform. Der DUDEN differenziert übrigens zwischen standardsprachlich Covid-19 und »fachsprachlich meist« COVID-19. (18. Mai 2020; Foto: kalhh)
Für die Lungenerkrankung, die durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelöst werden kann, existieren vor allem zwei Schreibungen: Covid-19 und COVID-19. Dabei gäbe es eine weitere Möglichkeit, die wie beim Virus an der Vollform orientiert wäre – schließlich handelt es sich bei CoV und COVID um Kurzwörter, die aus dem Wort (resp. der Wortgruppe) Corona Virus (Disease) gebildet worden sind. Der Orthografie des Virus entspräche also CoViD-19; so wird orthografisch auch bei einigen anderen Kurzwörtern verfahren (IdW, LfV, KiTa, GfdS). Auf welche Schreibung sollte nun also die Wahl fallen? Am transparentesten ist zweifelsohne CoViD-19, da die Großbuchstaben auf Wortanfänge hindeuten. Folgt man der WHO bzw. ihrer ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), verwendet man die Großschreibung COVID-19. Kleingeschrieben ist das Wort am auffälligsten, da nur wenige Kurzwörter, die auf Wortgruppen basieren, kleingeschrieben werden (Destatis, Haribo); selten, aber üblicher ist diese Orthografie bei Kurzwörtern, die auf einem einzelnen Wort basieren, bei denen also die Schreibung der Originalschreibung entspricht (Lkw, Kfz, Awo). Covid hat allerdings einen Vorgänger: Auch bei SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) wurde die Kleinschreibung Sars – nach anfänglicher Großschreibung – bevorzugt verwendet. Womöglich fand hier eine Anpassung an die grundlegende Orthografie der deutschen Sprache statt, begünstigt durch die Aussprachemöglichkeit der Kurzform, eine typografische Abschwächung und/oder die Unkenntnis der Vollform. Der DUDEN differenziert übrigens zwischen standardsprachlich Covid-19 und »fachsprachlich meist« COVID-19. (18. Mai 2020; Foto: kalhh)