KW 16/2019
Selbst oder selber?
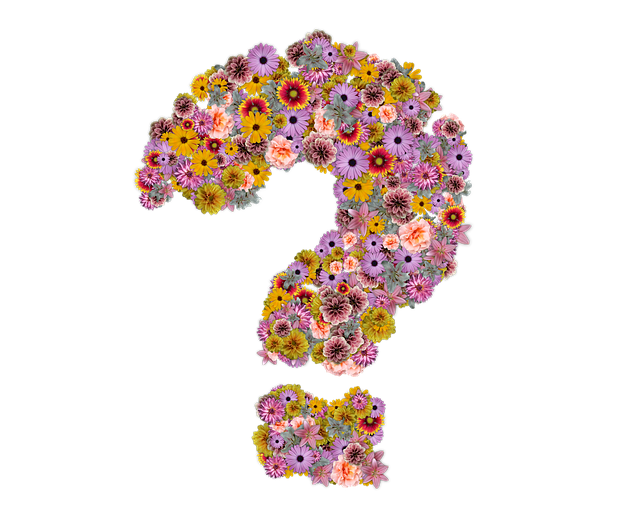 »Mach es doch selbst!« – »Klar, ich mache doch immer alles selber!« Die Pronomen »selbst« und »selber« sind undeklinierbar. Während die Form »selbst« eher der Standardsprache oder der gehobenen Sprache angehört, wird die Form »selber« teilweise als umgangssprachlich eingestuft.
»Mach es doch selbst!« – »Klar, ich mache doch immer alles selber!« Die Pronomen »selbst« und »selber« sind undeklinierbar. Während die Form »selbst« eher der Standardsprache oder der gehobenen Sprache angehört, wird die Form »selber« teilweise als umgangssprachlich eingestuft.
»Selbst« kann auch Bestandteil von Adjektivkomposita sein. Diese werden stets zusammengeschrieben: »selbstständig, selbstverständlich, selbstbewusst, selbstlos, selbstherrlich, selbstkritisch« etc. Wird »selbst« in Verbindung mit Verben verwenden, wird getrennt geschrieben: »selbst nähen, selbst backen, selbst kochen«. Zusammen mit einem adjektivisch gebrauchten Partizip ist sowohl Getrennt- als auch Zusammenschreibung möglich: »selbst gebastelte / selbstgebastelte Geschenke« oder »selbst gebackenes / selbstgebackenes Brot«. Der Rechtschreibduden empfiehlt hier allerdings die Getrenntschreibung. Nur zusammen wird »selbstredend«, »selbstklebend« sowie »selbstentzündlich« geschrieben, da hier jeweils »von selbst« gemeint ist. (15. April 2019)