KW 7/2017
»Geld-zurück-Garantie«, »Geld zurück Garantie« oder »»Geld zurück«-Garantie«?
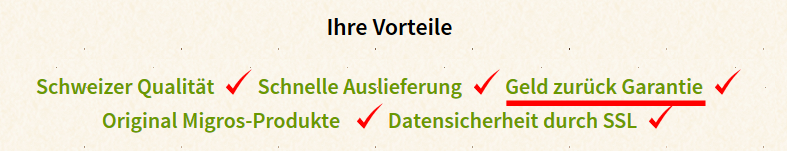 Was ist eigentlich eine »Geld zurück Garantie«? Richtig: Eine Garantie, dass man das Geld zurückerhält, wenn man mit dem gekauften Produkt nicht zufrieden ist. Im Deutschen können – wie wir hier sehen – aus Wortgruppen Komposita gebildet werden. Dies wird insbesondere dann genutzt, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und viele Informationen übermittelt werden müssen, wie zum Beispiel in Schlagzeilen, Titeln, in der Werbung oder auf kleinen Webseiten. Für die Schreibung sind dabei zwei Aspekte von Bedeutung, und zwar die sogenannte Durchkopplung und die Groß-/Kleinschreibung:
Was ist eigentlich eine »Geld zurück Garantie«? Richtig: Eine Garantie, dass man das Geld zurückerhält, wenn man mit dem gekauften Produkt nicht zufrieden ist. Im Deutschen können – wie wir hier sehen – aus Wortgruppen Komposita gebildet werden. Dies wird insbesondere dann genutzt, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und viele Informationen übermittelt werden müssen, wie zum Beispiel in Schlagzeilen, Titeln, in der Werbung oder auf kleinen Webseiten. Für die Schreibung sind dabei zwei Aspekte von Bedeutung, und zwar die sogenannte Durchkopplung und die Groß-/Kleinschreibung:
1) Damit der Leserschaft klar ist, dass es sich um ein Wort handelt, werden die einzelnen Bestandteile durchgekoppelt, also mit Bindestrich verbunden: Geld-zurück-Garantie. Alternativ können auch die Bestimmungswörter in Anführungszeichen gesetzt werden, dann wird lediglich ein Bindestrich vor dem Grundwort benötigt: »Geld zurück«-Garantie.
2) Der erste Bestandteil des Kompositums sowie alle Substantive werden großgeschrieben, alles andere klein: »das Latte-macchiato-Glas« oder »das Sowohl-als-auch«. (13. Februar 2017)